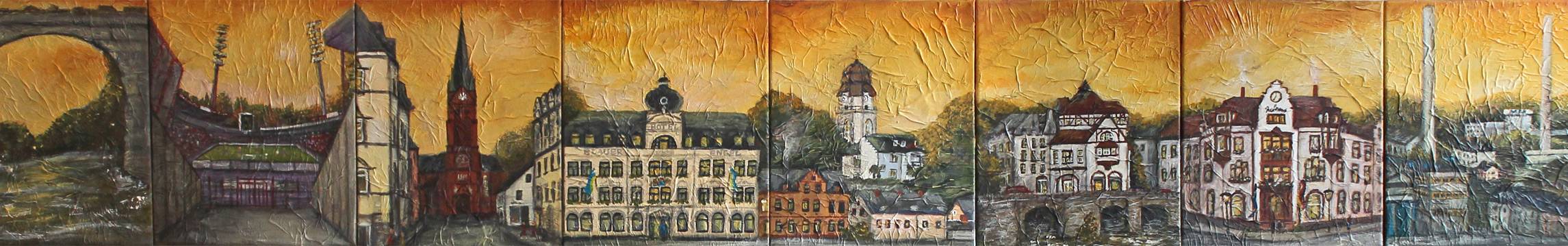Kulturhauptstadt - warum gewann Chemnitz den Titel?
Chemnitz hat es geschafft, sich nicht nur als Stadt mit großer Tradition und voller Umbrüche, sondern auch als Stadt der Macher und des Aufbruchs darzustellen. Zwar gilt die drittgrößte Metropole in Sachsen mit großer industrieller Vergangenheit noch nicht unbedingt als Hotspot, könnte es aber werden: "C the Unseen" – "Kommt uns besuchen, schaut, wer wir sind", So in etwa lässt sich das schließlich gefundene Motto auch übersetzen.
Dass die Stadt mit ihrer Bewerbung erfolgreich gewesen ist, liegt Beobachtern zufolge daran, dass sie kein Elite-Projekt war. Die freie Kulturszene und Bürgerinnen und Bürger seien von Anfang an sehr konsequent und transparent in den Bewerbungsprozess involviert worden. Das habe Energie und Entschlossenheit in den Prozess gebracht, der von der Jury als authentisch und bodenständig wahrgenommen worden sei.
Den rechtsextremen Ausschreitungen 2018 begegnete die Bewerbung mit einer klaren politischen Haltung, die für Weltoffenheit und ein Engagement der gesellschaftlichen Mitte eintrat. Nach dem gewaltsamen Tod des Deutsch-Kubaners Daniel H. im August 2018 am Rande eines Stadtfestes war Chemnitz nicht mehr aus den Schlagzeilen gekommen. Aufmärsche von Pegida, rechtsradikalen Bürgerinitiativen und der AfD provozierten Gegenproteste von Vereinen und Verbänden. Höhepunkt war das Konzert #wirsindmehr am 3. September. Mehr als 65.000 Menschen folgten dem Aufruf gegen Rassismus und Gewalt und erlebten ein Gratiskonzert von Künstlern wie der Chemnitzer Band Kraftklub, den Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet.
Hinzu kam, dass die Region rund um Chemnitz in die Bewerbung einbezogen wurde, über den Kunst- und Skulpturenweg Purple Path.

 Englisch
Englisch
 Tschechisch
Tschechisch
 Französisch
Französisch